erschienen in
Public Relations in Zeiten von Fake News, Shitstorms und Hatespeeches: Ein Werkzeugkoffer für kleine Organisationen
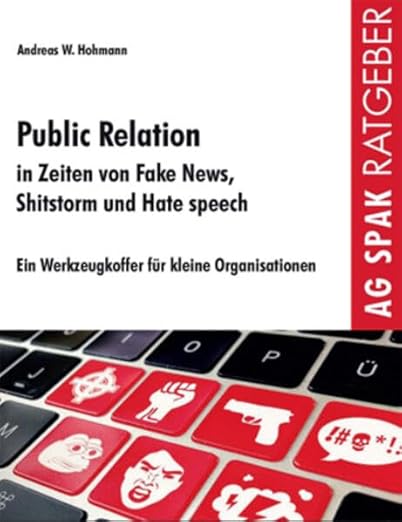
Der Ansatz der rezeptiv-reflexiven Wirkungsanalyse imaginierender Bilder wirft ein Licht auf die komplexe Beziehung zwischen Bild und Betrachter*innen. In einer Ära, in der visuelle Eindrücke ständig auf uns einprasseln, von den unzähligen Screens unserer digitalen Geräte bis hin zu den Werbetafeln, die unsere Städte schmücken, wird das Verständnis dieser Beziehung immer wichtiger. Dieser Ansatz, der sowohl rezeptive als auch reflexive Komponenten berücksichtigt, verlangt von uns, über die bloße Wahrnehmung hinauszugehen und uns mit der tieferen Bedeutung, die in den Bildern verborgen ist, auseinanderzusetzen. Es ist nicht nur das, was vor unseren Augen sichtbar ist, sondern auch das, was im Verborgenen liegt, das unsere Aufmerksamkeit erfordert. Durch das „(de)chiffrieren“, also das Entschlüsseln und Dekodieren, werden wir dazu angeregt, über die Absichten, Botschaften und den Kontext nachzudenken, in dem das visuelle Material präsentiert wird. Dabei spielen unsere eigenen kulturellen, sozialen und individuellen Vorerfahrungen eine entscheidende Rolle bei der Interpretation. In diesem Sinne bietet die rezeptiv-reflexive Wirkungsanalyse nicht nur ein Instrument zur Analyse visueller Medien, sondern auch einen Spiegel, in dem wir uns selbst und unsere Position in der von Bildern dominierten Welt erkennen können. Es ist ein Aufruf zur Wachsamkeit, zur kritischen Reflexion und zur ständigen Auseinandersetzung mit dem, was uns visuell [re]präsentiert wird.
Der Beitrag liefert entsprechend einen wichtigen Ansatz zur [de]chiffrierung imaginierender Bilder durch eine rezeptiv-reflexive Wirkungsanalyse, wie ich sie im Kontext meiner Forschungsarbeiten zum Visuellen Verstehen entwickelt habe. Gangbar gemacht wird damit ein wichtigen Beitrag in Zeiten von »realness und fake« – auch für NGOs.